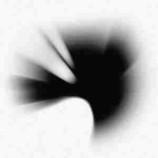Linkin Park: The Hunting Party
Linkin Park: The Hunting Party
Warner
VÖ: 13.06.2014
Wertung: 8,5/12
Linkin Park sind wütend. Und zwar so richtig. Gerade noch zerlegten die Kalifornier Rock Im Ring in seine Einzelteile, da dröhnt es auch aus der Konserve so richtig schön laut und aggressiv. „The Hunting Party“ ist der Tritt in die Fresse, den man den Herrschaften nicht mehr zugetraut hätte. Die letzten Jahre ging es ja zunehmend in eine elektronische Richtung und der gesamte Sound wurde immer seichter und poppiger. Jetzt präsentiert sich die Band so zornig wie seit den Anfangstagen nicht mehr. Linkin Park sind mit „The Hunting Party“ einer der letzten Überlebenden eines ganzen Genres – zumindest was den Superstarstatus betrifft. Korn oder Limp Bizkit wurden längst überlebt. Kritikerlieblinge werden aber Linkin Park wohl dieses Leben nicht mehr werden, daran wird auch „The Hunting Party“ nichts ändern.
Rick Rubin wurde diesmal auch nicht in das Studio zur Arbeit gebeten. „The Hunting Party“ wurde von der Band gleich in Eigenregie selbst produziert. Linkin Park tragen hier ganz dick auf. Vielleicht ist dabei sogar der eine oder andere Verstärker über die Wupper gegangen – die Drähte dürften jedenfalls ordentlich geglüht haben. Hier werden zwölf Bretter abgeliefert. Eine Dampfwalze fegt da über einen hinweg. Ausgelegt wurde das selbstverständlich für die Stadien dieser Welt. Wie sollte es auch anders sein, denn das passt ja in keinen Club. Man sollte sich aber auch nicht blenden lassen, denn „Until It´s Gone“ ist Pop – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Mit „Keys To The Kingdom“ kommen Linkin Park gleich mächtig angerollt. So aggressiv waren die Jungs schon lange nicht mehr. Hier prügeln sie alles ganz kompromisslos nieder. Die Produktion macht einen auf dicke Hose und doch kann man unter dem ganzen Brimborium die schönsten Harmonien und Melodien entdecken. Linkin Park können das wie keine zweite Band. „War“ geht gar noch mehr nach vorne. Chester Bennington reizt seine Stimmbänder derart aus, dass man sich schon Sorgen machen muss, ob diese halten werden. Die Nummer geht als eine Mischung aus Hardcore und Punk sehr schön nach vorne. „Wastelands“ erinnert in den Strophen ein bisschen an „The Beautiful People“ von Marilyn Manson, nur um dann in einen Refrain zu wechseln, der jeden Popsong ziemlich alt aussehen lässt.
Der zweite Song der Platte - „All For Nothing“ - drückt nicht ganz so auf das Tempo, geht aber gut in die Ohren und schafft es die perfekte Schnittmenge aus Computersounds, Gitarrengeschrammel und treibenden Drums zu bilden. Mit Page Hamilton von Helmet haben sie eine 90er Ikone als Gast dabei, der aber kaum auffällt. Das hier ist eben die große Linkin Park Show. „Guilty All The Same“ drückt dann zunächst wieder auf die Tube, ist aufgrund des Beitrags von Rakim aber ein feines Crossoverstück geworden. Die Emo-Schiene haben Linkin Park aber nicht gänzlich aufgegeben. „Rebellion“ knüpft in dieser Hinsicht an die Vorgänger an und die ganzen Taschenspielertricks können letztlich auch nicht verbergen, dass dies alles auf dem Fundament des Pop aufgebaut wurde. Daron Malakian sorgt dafür, dass die Alternative-Metaller daran ihre Freude haben werden. „Mark The Graves“ setzt danach kaum Akzente und ist eher unter Füllmaterial zu verbuchen. „Drawbar“ lässt anschließend wieder aufhorchen. Mit Tom Morello wagen sie sich in das Land der Experimente vor. Es ist ein sphärisches, ruhiges Stück ohne Gesang. „Final Masquerade“ schafft wieder den Spagat zwischen Pop und Rock – wobei der Fokus diesmal eindeutig auf den leichteren Klängen liegt. „A Line In The Sand“ bringt ganz zum Schluss auf über sechs Minuten auf den Punkt wofür „The Hunting Party“ steht: ein Leben zwischen kompromissloser Härte und poppigem Wohlklang, zwischen technisch gutem Gesang und Geschrei (Bennington) und Rap (Shinoda), zwischen elektrischer Spielerei und handgemachter Musik aus Gitarre, Bass und Drums. Sehr viel knüppelharten Drums!
Fazit: „The Hunting Party“ ist das Album, welches man Linkin Park nicht mehr zugetraut hätte. Das Ding rockt wie Sau. Der Pop ist dabei natürlich nicht verschwunden und sorgt für die nötigen Harmonien. Die Platte knüpft dabei sogar an die Anfänge an, umschifft die Peinlichkeitsgefilde aber sehr gekonnt und unterstreicht, dass auch Männer mittleren Alters noch aggressive Musik machen können. Die Produktion ist natürlich sehr amtlich und sehr amerikanisch übertrieben. Man muss das mögen, aber das Übertriebene schwingt eben immer mit. „The Hunting Party“ ist aber auf jeden Fall keine Enttäuschung und vielmehr eine dicke Überraschung!
Text: Torsten Schlimbach
Linkin Park: Living Things
Linkin Park: Living Things
Warner
VÖ: 22.06.2012
Wertung 8/12
Man kann nicht gerade sagen, dass die neue Platte von Linkin Park wie aus dem Nichts kommt. Seit ungefähr einem Jahr gibt es alle paar Tage eine Wasserstandmeldung. Mal wird davon gesprochen, dass es zurück zu den Anfängen geht, nur um dies nach kurzer Zeit wieder zu entkräften. Die Fans wurden mit einer Art Schnitzeljagd bei Laune gehalten und dann präsentierten Chester Bennington und Mike Shinoda zu Beginn des Jahres auch noch Teile von „Living Things“ der Presse. In Deutschland läuft die Promomaschine schon seit Wochen auf Hochtouren. Die wichtige Festivalkombination „Rock am Ring/Rock im Park“ wurde bespielt und zwischendurch auch noch die Zeit gefunden Stefan Raab einen Besuch abzustatten. Kurzum, Linkin Park haben sich mit massiven Aufwand zurückgemeldet.
Das war nach dem letzten – gemeinhin mittlerweile als Totalausfall – betitelten „A Thousand Suns“ auch bitter nötig. Der Single „Burn It Down“ kann man momentan ja kaum entkommen. Selbige wird zur Fußballeuropameisterschaft an prominenter Stelle ständig bei der Berichterstattung platziert. Geschickter Schachzug! Gleichwohl wird der Song auch schon wieder kontrovers diskutiert. Manche sind erschrocken, dass Linkin Park nun offensichtlich zu einer Popband mutiert sind, während die anderen die konsequente Weiterentwicklung begrüßen. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte.
Wer aufgrund einiger im Vorfeld getätigten Äußerungen gehofft hatte, dass Linkin Park mit „Living Things“ nun wieder die härtere Gangart einschlagen, der muss sich von dem Gedanken freimachen, denn sonst wird die neue Platte wieder eine große Enttäuschung werden. Auch die geäußerten Vergleiche von einigen vorschnellen Zeitgenossen mit „Physical Graffiti“ von Led Zeppelin und „The Wall“ von Pink Floyd sind – bei allem Respekt – ja nun totaler Quatsch. Man muss jetzt auch nicht von „einem der besten Alben des Jahrzehnts“ fabulieren, wie es schon wieder einige machen. „Living Things“ ist aber beileibe kein schlechtes Album!
Die im Vorfeld bemängelte kurze Spielzeit der Scheibe – wir unterhalten uns hier über 37 Minuten – erweist sich ausdrücklich nicht als Manko. Linkin Park kommen hier kurz und knackig auf den Punkt und somit gibt es kaum Längen. Abwechslungsreich ist die Platte sowieso. Chester Bennington sagte uns mal im Interview, dass Mike Shinoda bei Linkin Park den Unterschied ausmachen würde. Das kann man durchaus so stehen lassen. Zu einem Großteil dürften es seine Visionen sein, der die restliche Band auf „Living Things“ folgt. Die Songs wurden zwar gemeinsam geschrieben und Rick Rubin ist erneut für die amtliche Produktion mitverantwortlich, aber das könnte Shinoda mittlerweile auch alleine. Die Texte, die weit weniger politisch motiviert sind wie noch beim Vorgänger, stammen aus der gemeinsamen Feder von Shinoda und Bennington. Aus all´ diesen Mosaiksteinchen kann man gut ablesen, wer denn nun die Richtung vorgibt.
Ein Blick zurück ist dabei aber ausdrücklich gewünscht und erlaubt. Der Opener „Lost In Echo“ ist in gewisser Weise ein Sammelsurium aus allen Phasen von Linkin Park. Es gibt knallharte Raps, einen schönen Screamo-Part und jede Menge elektronische Spielereien. Es dürfte sich auch nicht gerade als hinderlich erweisen, dass der Refrain sofort im Ohr hängen bleibt. Etwas störend wirkt der Kirmesklimbim im Hintergrund. Aber so sind sie da drüben, über dem großen Teich. Immer schön auf dicke Hose machen und dies ist ja auch keine Garagenrockplatte.
Aber eine Platte mit Melodien, die Hitpotenzial hat. „In My Remains“ knallt vordergründig betrachtet schön rein, unter der Oberfläche und den ganzen Soundschichten ist das aber eine astreine Popballade. „Burn It Down“ hat sich zwischenzeitlich ja sowieso zu einem Pophit gemausert. „Lies Greed Misery“ wird danach wieder für Verwirrung sorgen, zumindest bei allen, die Linkin Park immer noch in die Nu-Metal Schublade stecken. Hip Hop ist angesagt, Freunde! Da kann sich der gute Chester im Refrain auch noch so die Stimmbänder wund singen. Als klassischer Linkin Park Track geht „I´ll Be Gone“ durch´s Ziel. Für so ein Ding sind sie auf jedem Album gut.
Danach folgt ein ungewöhnliches Doppel. „Castle Of Glass“ überrascht mit düsteren Keyboardflächen und einer schönen Gesangslinie. Noch bevor man denkt, dass jeden Moment der große Ausbruch kommt, ist das Stück auch schon wieder vorbei. Den gibt es aber anschließend mit „Victimized“. Diese Elektropunk-Nummer ist ein Brett und pflügt und bollert sich durch sämtliche Körperfasern. Dies ist mit Abstand der härteste Track von „Living Things“. „Roads Untraveled“ scheut auch vor einem Glöckchenspiel nicht zurück und ist insgesamt in der melancholischen Depriecke zu verorten. „Skin To Bone“ ist der einzige Ausfall der Platte. Das Stück ist nicht wirklich schlecht, nur ohne Höhepunkt leider auch etwas langweilig ausgefallen. Da zieht man sich schon lieber den Hip Hop von „Until It Breaks“ rein. Das kurze, instrumentale Zwischenspiel „Tinfoil“ überrascht danach noch mal, denn zumindest den Aufbau könnte man sich so auch von Muse vorstellen. Der Übergang zum bombastischen Popausklang von „Powerless“ ist nahtlos. Ende! Stille!
Fazit: „Living Thins“ setzt den eingeschlagenen Weg von „A Thousand Suns“ konsequent fort, vergisst dabei aber nicht die Bandvergangenheit wieder mit ins Boot zu holen. Die elektronische Spielwiese ist eben mittlerweile ein großer Teil von Linkin Park. Dies mag manch einer bemängeln, aber genau das ist auch der Grund, warum die Band als einzige aus dem Nu-Metal Fach immer noch erfolgreich ist. Zwischen Pop, Hip Hop und einem hin und wieder gesunden Härtegrad kann dieses Album durchaus überzeugen. Es wird sicher nicht als bahnbrechendes Meisterwerk in das Jahrzehnt eingehen, ist eben aber auch weit von einem Reinfall entfernt. Linkin Park sind längst erwachsen geworden und dies hat auch eine interessante (musikalische) Entwicklung mit sich gebracht!
Text: Torsten Schlimbach
Linkin Park: A Thousand Suns
Linkin Park: A Thousand Suns
Warner
VÖ: 10.09.2010
Wertung: 8/12
Mit “A Thousand Suns” haben sich Linkin Park an ein Konzeptalbum gewagt. Viele vor ihnen sind daran gescheitert und auch die Fans von Linkin Park werden schwer an diesem Teil zu knabbern haben. Leicht verdaulich ist jedenfalls anders. Und genau das ist auch die Stärke dieser Scheibe. Vermeintliche Hits sucht man nämlich zunächst vergeblich. Das war auch so gewollt, denn die Band möchte dieses Album als Gesamtheit verstanden wissen und man sollte es auch so hören. Und nur so funktioniert “A Thousand Suns” auch tatsächlich. Man kann Linkin Park jedenfalls nicht vorwerfen, dass sie mit diesem Werk die Sicherheitsnummer gefahren sind. Schön, wenn eine Band etwas wagt. Das kann natürlich auch eine totale Bruchlandung werden und Fans und Kritiker vor den Kopf stoßen.
“A Thousand Suns” wird die Lager spalten, so viel dürfte klar sein. Wer die Band bisher für die lauten Ausbrüche, donnernde Gitarren und deren Hang zu Nu-Metal geschätzt hat, wird sich nun ratlos am Kopf kratzen. Die Gitarren sind nämlich deutlich in den Hintergrund getreten und auch die bekannten Schreiattacken sind so nicht mehr vorhanden. Dafür hat die Band eine gehörige Portion Elektronik in die Musik einfliessen lassen. Derart konsequent haben sie das bisher noch nicht gemacht.
Die einzelnen Songs gehen auch nahtlos ineinander über, was an den ganzen Interludes bzw. Intros liegt. Hierdurch relativieren sich auch schnell die 15 Tracks, denn effektiv gibt es neun. Das “nur” kann man sich an dieser Stelle schenken, denn so wirkt das nicht zu überladen. Die Band hat vermutlich schon im Vorfeld geahnt, dass die Fan-Reaktionen auf dieses Album heftig ausfallen könnten und so haben sie immer wieder verlauten lassen, dass “A Thousand Suns” anders sein wird. Ein geschickter Schachzug und gleichzeitg haben sie auch Wort gehalten.
Mit “The Requiem” und “The Radiance” wird die Geschichte eingeläutet. Nicht etwa mittels Songs, sondern durch sphärische Klänge, die den Zuhörer langsam an das Album heranführen. Den ersten richtigen Song gibt es dann erst mit dem dritten Track – “Burning In The Skies”. Die Band legt hier viel Wert auf einen Spannungsbogen und baut das Stück ganz langsam auf. Linkin Park haben den Rock eingemottet und den Pop für sich entdeckt. Gerade Chester Bennington drückt der Nummer seinen Stempel auf. Zum Schluss dürfen dann auch die Gitarren noch etwas Funken versprühen, aber die alten Zeiten scheinen vorbei zu sein. Andere werden das als weichgespült bezeichnen und wieder andere als perfekte Popmusik. Nach einem weiteren Interlude geht es mit “When They Come For Me” in Richtung orientalischer Rap. Hier wurde eindeutig viel Wert auf den Beat gelegt, selbiger kommt auch recht aggressiv rüber, ist streckenweise sehr reduziert. Pekussion ist eben alles. Zwischendurch geht es immer wieder in Richtung Orient. Ungewöhnlich, könnte live aber durchaus ein Kracher werden. Pianoklänge läuten anschließend das sehr ruhige “Robot Boy” ein. Der mehrstimmige Gesang macht sich auch im Radio ganz gut. Für die aufrechte Rockfraktion ist das sicher nix, aber wer auf atmosphärische Songs abfährt, sollte hier mehr als nur ein Ohr riskieren.
“Waiting For The End” dürfte die nächste Single werden. Fängt an wie der Batman-Song von U2, wechselt dann aber schnell die Richtung und ist ebenfalls sehr beatorientiert. Es ist etwas schade, dass die Band hier auch stellenweise zu seicht vorgeht. Der mehrstimmige Part reißt allerdings alles wieder raus. Fans der ersten Stunde kriegen immerhin bei “Blackout” einige Schreianfälle von Chester serviert. Geht doch! “Wretches And Kings” beginnt mit einer Rede des Bürgerrechtlers Mario Savio. Danach wechseln sich Shinoda und Bennington ab, wodurch das Stück insgesamt mehr in die Rapecke geht. Zum Schluss darf Joe Hahn noch an die Turntables wechseln und da dürfte die Linkin Park-Fanwelt doch wieder im grünen Bereich sein. “Widsom, Justice And Love” geleitet das Album dann aber wieder sanft hinüber in Richtung Pop, denn das ruhige “Iridescent” ist nichts anderes. “The Catalyst” kennt man ja schon länger und man hätte gerne so manchen Linkin Park-Fan beim ersten Genuss des Songs gesehen. Und zum Schluss? Da hauen die mit “The Messenger” mal eben einen Akustiksong raus. Tja, da werden einige aber ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt haben. Linkin Park klingen im Jahre 2010 fast wie eine neue Band.
Fazit: Mit “A Thousand Suns” haben Linkin Park eine gehörige Kurskorrektur vorgenommen. Dem pubertierendem Nu-Metal Gedöns haben sie abgesagt, dafür gibt es nun eine poppige und elektronische Ausrichtung. Der Fokus liegt mehr auf dem Gesang und so mancher sphärischen Melodie. Der Umstand, dass die Scheibe eigentlich nur komplett am Stück funktioniert, macht es sogar noch besser. Weniger bis gar keine Hits, dafür stimmt das Gesamtpaket. Mal gucken, was die Geschmackspolizei sagt.
Text: Torsten Schlimbach